Mit Erbsen begann es
Die Gentechnik nahm ihren Anfang im Garten eines Klosters in
Brünn. Dort
hat ein gewisser Gregor Johann Mendel jahrelang Erbsen gepflanzt,
geerntet
und ausgezählt. Herausgekommen sind die Mendelschen Gesetze, die
Grundlage
der Genetik. Mendel erkannte die Zusammenhänge des Vererbens. Er
hatte
nämlich nicht einfach Erbsen gezüchtet, er hat sie gekreuzt
und aus seinen
Aufzeichnungen diese grundlegenden Erkenntnisse gewonnen.
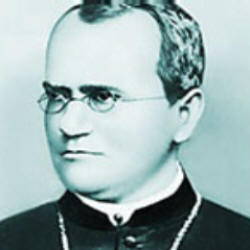 Mendel wurde als der Bauerssohn Johann Mendel in Nordmähren geboren
Mendel wurde als der Bauerssohn Johann Mendel in Nordmähren geboren
(den Namen Gregor nimmt er erst nach seiner Priesterweihe an). Um seine
intelligente
Veranlagung zu fördern, wurde er auf das Gymnasium in Troppau
geschickt.
Nach der Schule studierte er an der Universität in Olmütz.
1843 beschloß der einundzwanzigjährige Mendel ins
Augustinerkloster in
Brünn einzutreten. Er studierte Theologie, Agrikultur und Botanik
und
wurde zum Priester geweiht.
Von 1851 bis 1853 studierte er an der Universität Wien Mathematik
und
Physik.
1854 kehrte er ins Kloster zurück und unterrichtete dort für
die nächsten
vierzehn Jahre.
1856 begann Mendel seine berühmten Erbsenversuche (später
auch mit
Bohnen).
Gregor Mendels Arbeiten wurden 1865 veröffentlicht und blieben
jahrzehntelang unbeachtet bzw. unverstanden.
Sie wurden erst Anfang des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt.
Erst 35 Jahre später erkannten drei Wissenschaftler,
unabhängig
voneinander, die Bedeutung der Mendelschen Gesetzte.
Hatte Mendel die Tür aufgeschlossen, blieb es C. E. Correns, E.
Tschermak
und H. de Vries überlassen, diese aufzustoßen.
Mendel gilt mit den Vererbungsregeln, die er bei seinen Studien
erkannte,
als Vater der Genetik.
In Kreuzungsversuchen entdeckte Mendel, daß einige genetische
Eigenschaften dominant vererbt werden.
Das heißt, sie werden an alle Nachkommen weitergegeben.
Andere genetische Merkmale werden dagegen rezessiv
vererbt.
Dies wiederum heißt, daß beide Elternteile das genetische
Merkmal bei sich
tragen müssen,
damit es bei einem Nachkommen sichtbar wird.
Noch heute bilden die Mendelschen Gesetze die Grundlagen für die
Vererbungslehre, für die Genetik.
|
Das 1. Mendelsche Gesetz
oder Uniformitätsgesetz
oder auch Reziprozitätsgesetz
|
Kreuzt man zwei reinerbige
(=homozygote) Individuen
miteinander, so gleichen sich alle Individuen der Filialgeneration
F1.
|
|
Das 2. Mendelsche Gesetz
oder auch Spaltungsgesetz
|
Kreuzt man die entstehende
Filialgeneration F1, so
spaltet sich die entstehnde Filialgeneration F2 im Verhältnis 3:1
oder
1:2:1 (je nachdem, ob dominant-rezessiver oder intermediärer
Erbgang).
|
|
Das 3. Mendelsche Gesetz
oder Unabhängigkeitsgesetz
oder auch Neukombinationsgesetz
|
Kreuzt man Individuen, die sich in 2 Merkmalen reinerbig
unterscheiden, so
werden die Merkmale unabhängig voneinander vererbt. In der
F2-Generation
können reinerbige Neukombinationen auftreten.
|
|
Einschränkung: Die freie Kombination gilt nur,
soweit die Anlagen nicht
auf einem, sondern auf verschiedenen Chromosomen liegen. Das bedeutet,
daß
es z. B. bei drei Merkmalen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten
gibt,
nach denen die Anlagen zu einer Keimzelle
zusammengesetzt werden können.
|

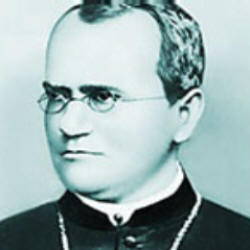 Mendel wurde als der Bauerssohn Johann Mendel in Nordmähren geboren
Mendel wurde als der Bauerssohn Johann Mendel in Nordmähren geboren